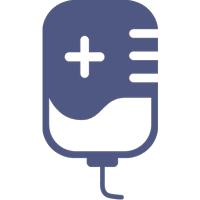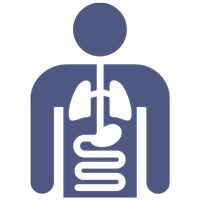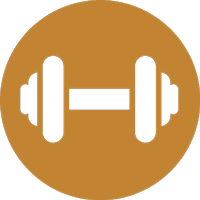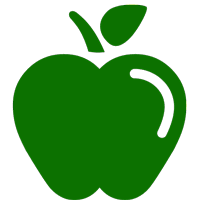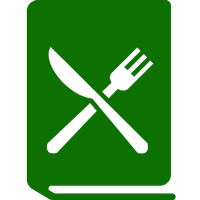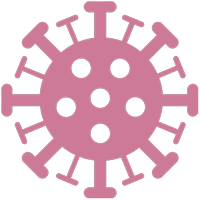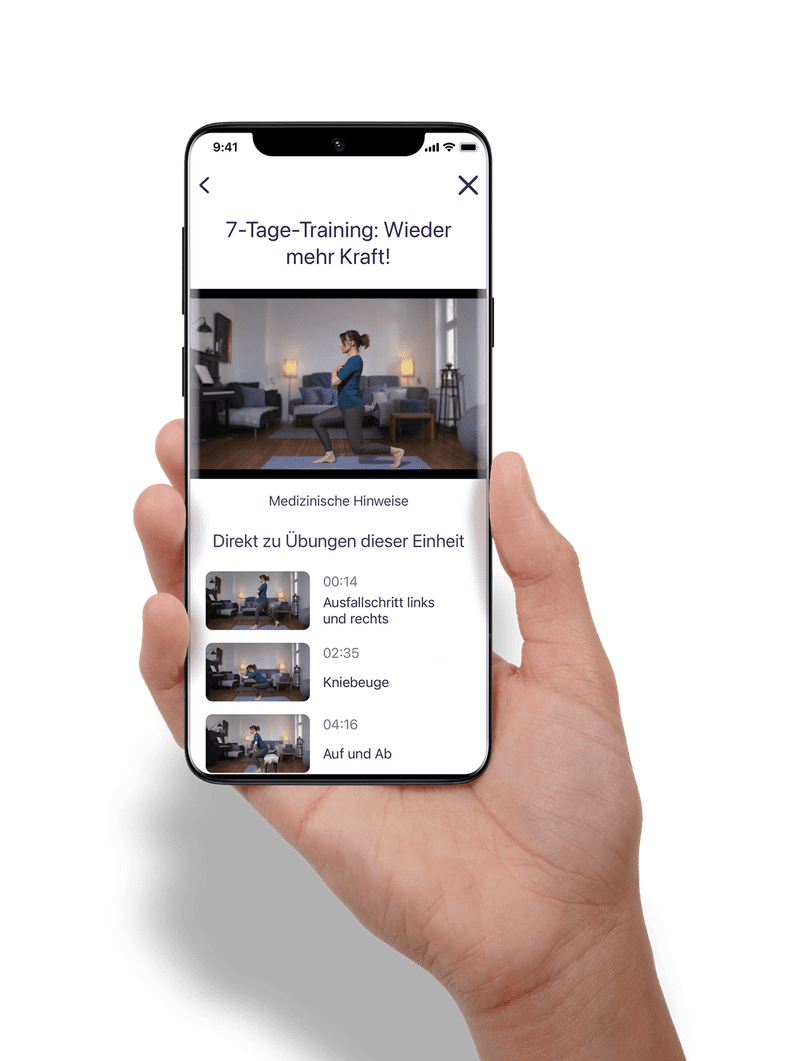Darmkrebs: Warum gesellschaftliche Reaktionen auf Krebskranke schwerer zu verarbeiten sind, als der Krebs selbst.
Im Englischen unterscheidet man zwischen sex und gender, also zwischen dem biologischen und sozialen Geschlecht. Das Geschlecht eines Menschen ist also u.a. abhängig von seinen sozialen und kulturellen Prägungen, auf das Geschlecht bezogenen Verhaltensweisen, Eigenschaften und Interessen [1]. Diese Prägung wird besonders eklatant, wenn Männer krank werden.
Männer und Krebs
In diesem Zusammenhang müssen wir uns fragen, ob es wirklich sein kann, dass eine Krebserkrankung nicht nur gesundheitlich beschwerlich ist, sondern auch sozial? Dass ein Patient von seinem näheren Umfeld stigmatisiert wird und von den eigenen Gefühlen? Eine Studie an Darmkrebspatienten in einer Reha-Klinik hat genau das jetzt gezeigt. Danach fühlen sich besonders Männer mit Darmkrebs ihrem Selbstbild bzw. ihrer Identität beraubt. Anstatt zum starken Geschlecht gehörig, werden sie sich jetzt ihrer Verletzlichkeit und Schwäche bewusst, fühlen sich existentiell bedroht und gedemütigt. Sie werden nicht nur durch andere stigmatisiert, sondern sie stempeln sich auch selbst ab, was besonders schlimm für das Selbstwertgefühl ist und die notwendige Mobilisierung rehabilitativer Kräfte bereits im Ansatz erstickt.
Man darf nicht vergessen, dass eine chronische Krankheit, wie Krebs, das gesamte Leben von jetzt auf gleich komplett umkrempelt. Wer sich bis dahin noch nicht damit auseinandergesetzt hat, findet in der Literatur zahlreiche Berichte über die Folgen einer Krebsdiagnose. Außenstehende sehen oft nur die körperliche Beeinträchtigung, die Betroffenen haben sich aber in Wirklichkeit mit einem tiefen Eingriff in die Selbstwahrnehmung, die sozialen Kontakte und den Sozialstatus auseinanderzusetzen. Natürlich können die Gefühle und Erfahrungen individuell ganz unterschiedlich sein. Sie haben aber in fast allen Fällen mit Ausgrenzung, Scham und Einsamkeit zu tun. Dazu kommen die sichtbaren Zeichen einer Krebsbehandlung, wie Haarausfall, Gewichtsverlust und Narben, die es unmöglich machen, sich vor dem Urteil anderer zu schützen. Selbst heute noch haben es Männer besonders schwer, wenn sich ihr Außen- und Selbstbild stark verändert und sie sich neu definieren müssen, denn der Druck durch die Geschlechtsrollenerwartungen ist nach wie vor enorm groß.
Der Soziologe Erving Goffman spricht in diesem Zusammenhang von einer „Patientenkarriere“[1]. Sie besagt, dass Menschen von der Diagnose an quasi aus ihren gewohnten Alltagsschuhen herausgerissen und oftmals zu „uneingeschränkten Kranken“ gemacht werden. Dieser abrupte Rollenwechsel vom Gesunden zum Kranken geschieht so schnell, dass nach dem Diagnoseschock die Verarbeitung des „Statuswechsels“ oft Wochen, Monate oder Jahre hinterherhinkt. Die Patienten neigen derweil dazu, sich zurückzuziehen und von gesellschaftlichen Ereignissen zu isolieren, vielleicht, um sich nicht rechtfertigen oder aber mit hilflosem Schweigen konfrontieren zu müssen.
Die allgemein gepflegte Haltung, dass Gutes nur guten Menschen passiert und umgekehrt, vermittelt Menschen das Gefühl, dass das Leben kontrollierbar sei. Die Folgen einer solchen „Schutz-Meinung“ sind dagegen fatal, führen sie doch eben zur Stigmatisierung, damit man einer Situation nicht hilflos ausgeliefert ist. Sie führt zu Distanz- und Vermeidungsverhalten, lässt Beziehungen einfrieren und macht intime Gespräche und Körperkontakte schwer. Kein Wunder also, dass sich Krebskranke selbst im Familienkreis manchmal isoliert fühlen. Sie beginnen sich zurückzuziehen, pflegen ihre Hobbys nicht mehr, nehmen nicht mehr an Aktivitäten teil und leiden stattdessen zunehmend unter Schuld- und Schamgefühlen. Ältere Krebskranke werden vielleicht beruflich degradiert und ausgegrenzt, möglicherweise sogar entlassen, was der Gesundung durch die Aussicht auf eine berufliche Rehabilitation extrem entgegensteht.
„Wenn Menschen einander begegnen, begegnen sie zu allererst Körpern“
Zwischen 2011 und 2012 wurde in einer Rehabilitationsklinik eine Studie mit Darmkrebspatienten durchgeführt. Ihr lag die Frage zugrunde, wie die Männer und Frauen mit Stigmatisierung umgehen. Gerade der Darmkrebs ist ja mit vielen Vorurteilen und Tabus belegt, nicht zuletzt durch das, zumindest zeitweise, Tragen eines künstlichen Darmausganges.
Im Patientenalltag müssen sich die Betroffenen zuerst mit dem Diagnoseschock und den Ohnmachtsgefühlen auseinandersetzen, dann mit der veränderten Körpererfahrung, mit dem Gefühl, nun plötzlich anders zu sein und von der gesellschaftlichen Norm abzuweichen. Während Frauen vor allem den Haarausfall fürchten, leiden Männer mehr unter der deutlich sichtbaren Gewichtsabnahme und dem Verlust an Vitalität, die den „Rollentausch“ noch einmal plakativ unterstreichen und bei Gesunden Rückzug oder sogar Ablehnung hervorrufen können.
Nun erfüllen die Patienten nicht mehr die Körpernorm, sind nicht länger leistungsfähig, sondern fortan beeinträchtig von einer Krankheit, die sie in Anspruch nimmt. Die Erkrankten erleben nun, anstelle selbstbestimmten, aktiven und erfolgreichen Handelns, mehr und mehr körperliche Einschränkungen, passives Erdulden und Rückzug. Gerade für Männer passt das überhaupt nicht zu ihrem Selbst- und Rollenbild, sie wollen sich möglichst schnell zurückkämpfen, wieder die geforderten Leistungen erbringen und arbeiten – um jeden Preis. Sie messen sich an ihren früheren Leistungen und können dabei leider nur verlieren. Die Männlichkeit steht und fällt mit der Leistungsfähigkeit, so haben sie es gelernt. Da kann es keine Phase der Akzeptanz geben, vielmehr wird die Frustration mit jedem vergeblichen Versuch von Kraft- und Mobilitätstraining tiefer. Ihr Körper verweigert die Kontrolle, doch sie haben gelernt, die Kontrolle zu bewahren. Aus etwas Selbstverständlichem (eben dem Körper) ist etwas geworden, dem man nicht mehr zu 100% vertrauen kann. Jetzt befinden und entscheiden andere über den eigenen Körper, jede Kontrolluntersuchung kann diesen Gefühlen Nahrung geben. Strategisch versuchen sie, sich vor der Öffentlichkeit zu tarnen und Unverletzlichkeit vorzugeben, damit niemand den Patienten in ihnen sieht. Anteilnahme, Fürsorge und Mitleid sind häufig für Männer nur sehr schwer zu ertragen. Gleichzeitig finden sie keine Möglichkeit, ihren Sorgen und Ängsten Ausdruck zu verleihen. Denn darüber „spricht Mann nicht“.
Besonders die Patienten mit künstlichem Darmausgang (Stoma) haben Angst davor, als abstoßend zu gelten und versuchen das Stoma durch ausgewählte Kleidung zu kaschieren. Alle Handgriffe, die früher einmal selbstverständlich waren, müssen jetzt wohlüberlegt sein. Schwimmbadbesuche, Menschenansammlungen, Tanzen, lange Ausflüge, Theater oder Kino sind mit Stoma und ohne beschämende Fragen nicht mehr so leicht möglich. Auch größere Operationsnarben können eine solche Scham auslösen. Schließlich können die sozialen Begleiterscheinungen und Reaktionen der Umwelt ein größeres Leiden hervorrufen, als die Krankheit selbst. Die daraus resultierende soziale Isolation verringert eklatant die Lebensqualität [3].
So wie es bei psychischen Erkrankungen schon Usus ist, könnten Anti-Stigma-Kampagnen, medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitationsmaßnahmen, Teilzeit-Modelle am Arbeitsplatz, die Entmachtung alter Rollenbilder und die Aufklärung der Öffentlichkeit helfen, die sozialen Begleiterscheinungen von Krebs zu reduzieren, den Kranken eine Ausdrucksform für ihr Leiden zu geben und ihnen als Mensch anstelle als starken Mann und Ernährer wertschätzend gegenüber zu treten [4].
| Wir alle sollten uns darin üben, uns in andere hinein zu fühlen und anderen den Halt geben, den sie in ihrer augenblicklichen Situation brauchen. Denn wie schlimm ist es, dass kranke Menschen mehr unter den Blicken anderer leiden, als unter der Krankheit selbst? Es liegt in der Hand eines jeden, dass das nicht geschieht. |
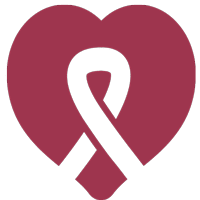
Mentales Training senkt Stresshormone
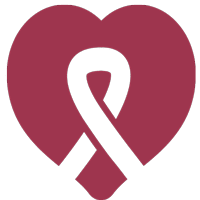
Psychoonkologie – Notwendig oder nur noch ein Arzt mehr?
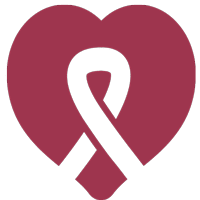
Ich, mein bester Freund.
- Von Engelhardt, M. (2010). Erving Goffman: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. In Schlüsselwerke der Identitätsforschung (pp. 123-140). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reuter, Tim und Julia, 05.06.2018 in SozProb (2018) 29:69–87, Darmkrebs als Stigma? Befunde einer (Reha)Klinikstudie mit männlichen Betroffenen, abgerufen am 27.07.2019
- Ernst, J. et. al. in BMC Cancer. 2017 Nov 9;17(1):741, Perceived stigmatization and its impact on quality of life – results from a large register-based study including breast, colon, prostate and lung cancer patients, abgerufen am 27.07.2019.
- Felix-Burda-Stiftung, Darmkrebsvorsorge Beratungsstellen, abgerufen am 27.07.2019.